
K4_2_B
www.drahtton.de
|
<- Anfänge der magnetischen Aufzeichnung |
Übersicht |
-> Bastelarbeit unserer Tochter |
Bilder einer Drahttongerät Restaurierung

Das Gerät
entstammt einer „Musiktruhe“, wo es wohl einem Plattenspieler weichen musste?!
Äußerlich komplett, am Tonarm und
den Tonarm-Ablagen sind Teile abgebrochen. Das kriegen wir.
Der Zustand ist bescheiden,- das wichtigste aber ist, es ist komplett!! Alles andere ist machbar.
Das Bild
zeigt unten links den Tonkopf und den roten Knopf TRYK, den man drücken muß,
wenn durch das Bandende oder
schlimmer durch einen Drahtbruch der Abschaltauslöser aktiviert wurde.

K4_2_B2
Zu
Produktionszeiten gab es vielfach noch Gleichstrom zur Versorgung von
Haushalten. Deshalb hier ein Umschalter von
Gleich- zu Wechsel-Spannung.

K4_2_B3
Nach der
Aufarbeitung. Gewissensfrage: Soll man die angerosteten Originalschrauben
belassen oder durch neue
glanzverzinkte Zylinderschrauben ersetzen?

K4_2_B4

K4_2_B5
Ab in die Badewanne:

K4_2_B6

K4_2_B7

Der innere
Zustand eines Koffergerätes. Das wichtigste, es ist fast komplett!!! Das
bedeutet, dass ich weiß, welche Teile
ich besorgen muss, - ein Schaltbild würde sehr viel schneller zum Ziel führen.
Fehlanzeige. Ich habe nun fünf D
rahttongeräte, - aber noch nie ein Schaltbild gesehen. Die Probleme sind die
freie Verdrahtung der Bauteile (Platinen
gab es noch nicht) und die Wickelkondensatoren, die über die Jahre gern
Feuchtigkeit ziehen. Die Kapazität nimmt
immer weiter ab bis zum Durchgang. Hat ein Koppelkondensator keinen
nennenswerten Widerstand, bedeutet das
den baldigen Exitus der entsprechenden Röhre! Diese Kondensatoren sind meist
Hochvolttypen, die sich schlecht
prüfen lassen und heute schwer zu beschaffen sind.

K4_2_B9

K4_2_B10


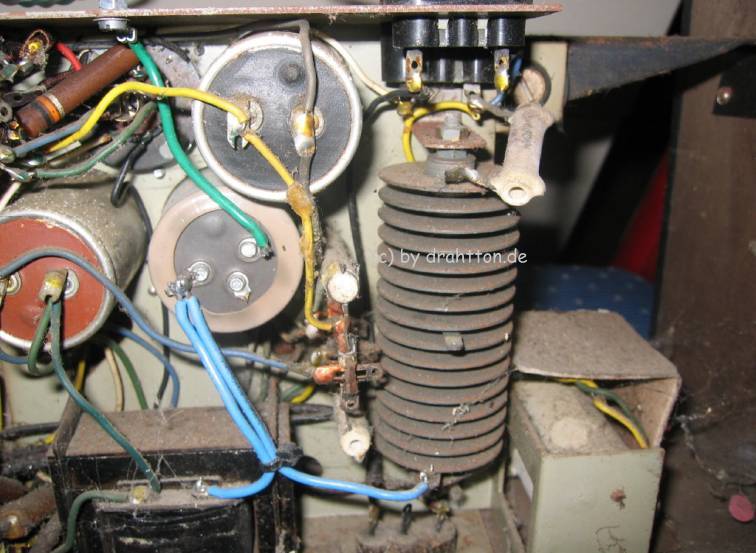
Zum Beispiel Aufarbeit eines Reibrades (was für ein Glück nicht nach einem Ersatzteil suchen zu müssen). -Ersatz gibt’s nicht!
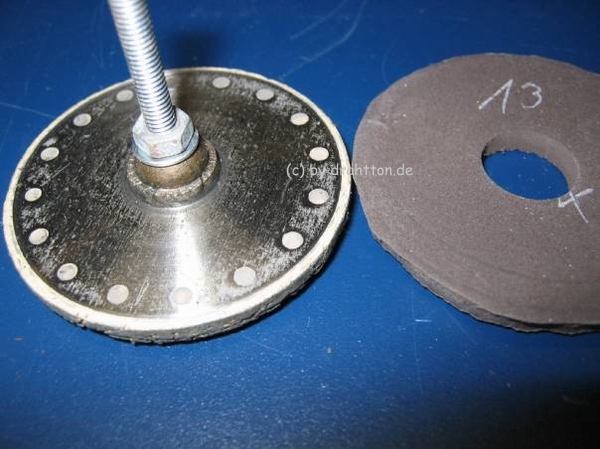
K4_2_B14

K4_2_B15


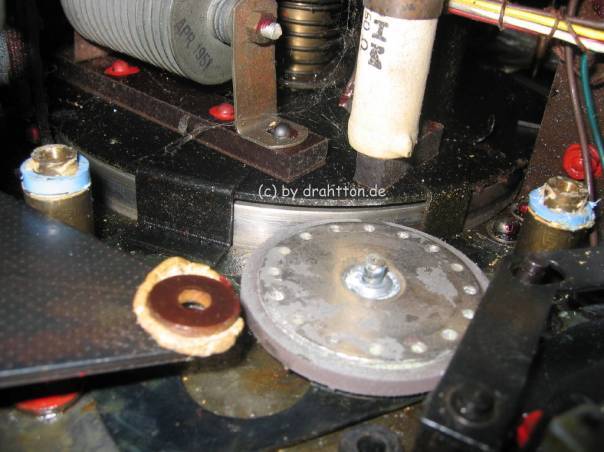
Das
erneuerte Reibrad überträgt die Drehbewegung des „Plattentellermotors“ auf den
Plattenteller.
Von der Plattentellerwelle geht es über eine Filz-Friktions-Kupplung zu einer
Schneckenverzahnung
auf eine bronzefarbene Welle in einem Hüllrohr zu einer Kurvenscheibe, die
ihrerseits den Tonkopf
gleichmäßig hebt und senkt. Am unteren Bildrand ist die Spiralfeder zu
erkennen, die mit einer penibel
einzustellenden Vorspannung den Reibwert bestimmt. Ist das Losbrechmoment nur
geringfügig zu groß,
kann das zum Drahtriss führen. Einen Drahtriss kann man theoretisch
verknoten(s.o.). Wer das
womöglich mehrmals machen musste, hat bestimmt früher oder später nach einem
TonBANDgerät
geschielt. Hinzu kommt, dass, wenn dieser spezielle Knoten wieder die feine Nut
im Tonkopf passieren
muss, er dort irgendwann wieder reißt.
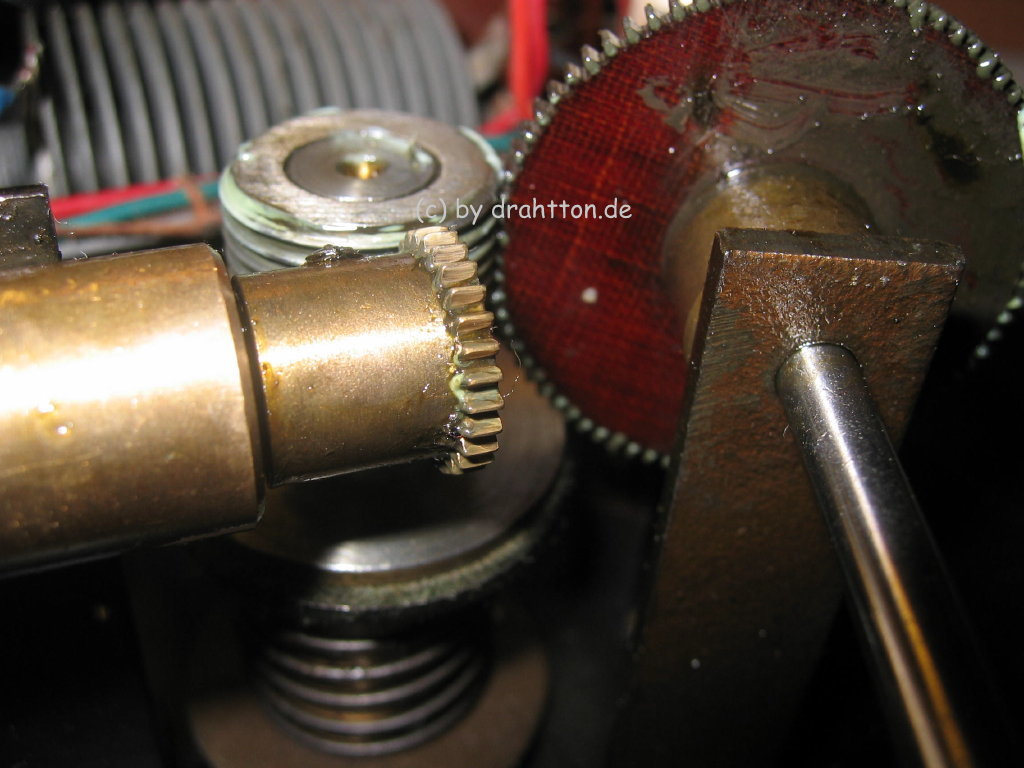
K4_2_B19

Dieses ist der Band-(pardon) der Draht-Endabschalter.
Wenn der
Draht einmal reißen oder einfach nur zu Ende sein sollte, verschiebt das
Drahtende oder besser
ein am Drahtende befestigtes Fähnchen diesen filigranen Hebel. Das Hebelchen
wird seinerseits von zwei
noch filigraneren Federdrähtchen in seiner Mittelstellung gehalten, wobei der
Motorstromkreis an dieser
Stelle geschlossen ist.
Was
passieren würde, wenn diese Abschaltung versagt, wird sich jeder Tonbandfreund
aus eigener Erfahrung
sicherlich vorstellen können. – Nur, daß wir es hier nicht mit einem Band zu
tun haben, sondern mit einem
haarfeinen Draht, der immer dann reißt, wenn er es nicht soll.
Meine Frau
hat über einige Tage einen Teil ihrer Freizeit damit verbracht zu versuchen,
einen Draht ohne Drall
und ohne Knick wieder auf die Spule zu bekommen. Schließlich nahm sie die
Schere und ich musste ihr
versprechen, eine neue Spule zu besorgen. Beim freundlichen HiFi-Händler um die
Ecke??!
Die
Antriebsmotoren:
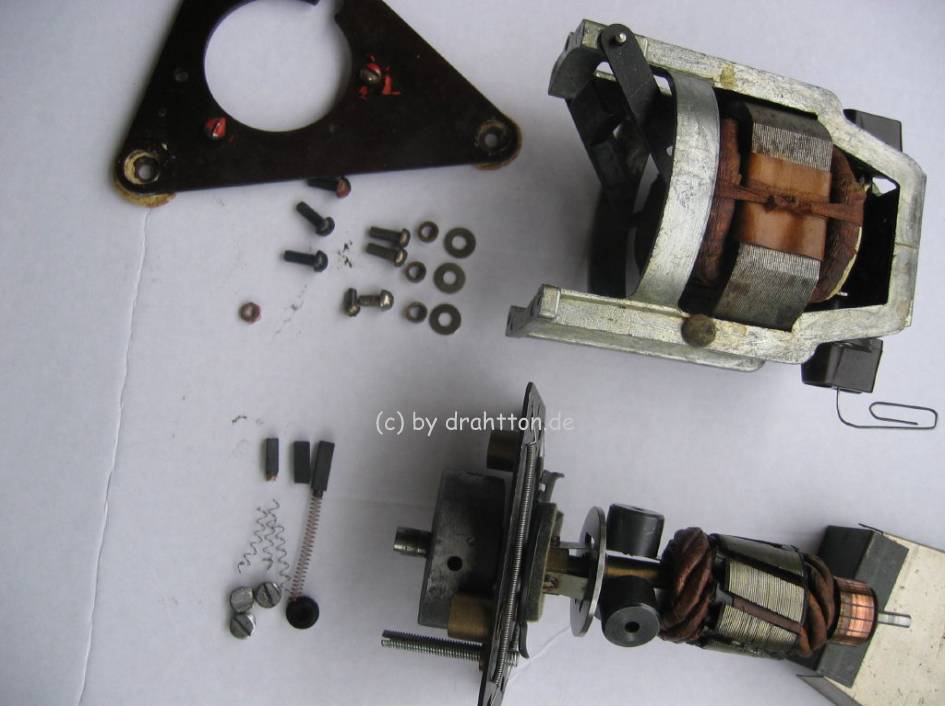
K4_2_B21
Ein
Schlosser muß versucht haben das Gerät (kaputt) zu reparieren. Oben im Bild
passend zurechtgeschliffene Kohlen mit
passender Feder und Bakelitverschluß. Die wie selbst gewickelt aussehenden
Federn, waren zu kurz und aus viel zu hartem
Material. Sie hatten sich zusammen mit den viel zu kleinen Kohlen in der
Bürstenführung verkantet, wobei der Kollektor
tiefe Riefen bekam und überschliffen werden musste.
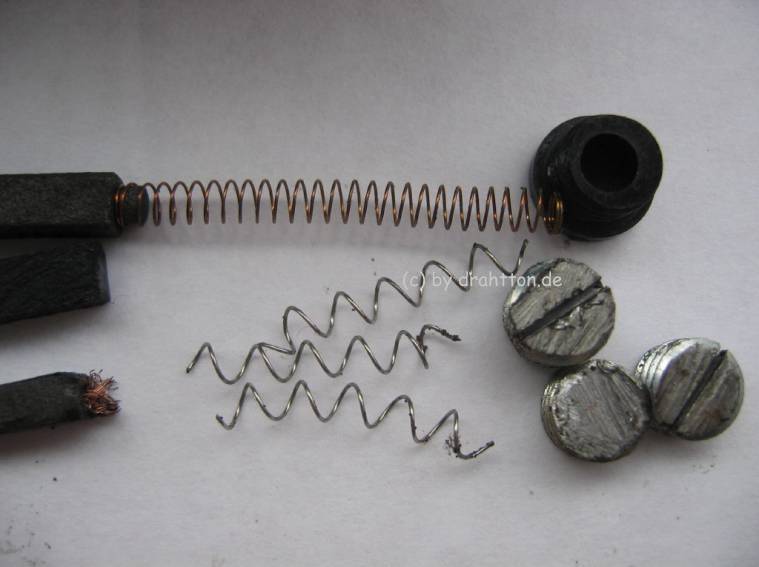
K4_2_B22

K4_2_B23
Hier sind
die Fliehkraft-Gewichte zu sehen, die bei zunehmender Drehzahl nach außen
wandern und über die Blattfedern
die silberne Friktionsscheibe gegen den Filz drücken. Hierdurch wird der Motor
abgebremst und durch dieses ständige
Wechselspiel auf eine feste Drehzahl geregelt. Der Filz wird leicht
eingefettet, wodurch die Regelmechanik verschleißfrei
arbeitet. (Nebenbei,- ohne Service-Unterlagen den best geeigneten
Reibkoeffizienten zu finden und durch zahlreiche
Fehlversuche die Blattfedern zurückbiegen zu müssen, war eine Beschäftigung von
Tagen.) Wenn der Motor dann aber
fast vibrationsfrei in der Hand gehalten läuft und sich ruckfrei regeln lässt,
ist das ein tolles Gefühl und der Lohn dieser
„Pionierarbeit“! Ich denke, dass dieses Nachvollziehen der alten Ingenieursarbeit
und die Instandsetzung für mich die
Faszination mit der Beschäftigung von Tonbandgeräten ausmacht.
(Hätten es dann nicht ebenso gut Schreib- oder Nähmaschinen sein können . .
.?!)

K4_2_B24
Der
Sollwert der Drehzahl wird über die Vorspannung dieser Federn erreicht. Die
hierfür vorgesehende Schraube ist
durch eine Öffnung von außen gut zugänglich. Leider aber nur für den
Plattenteller-Motor. Der Spulmotor muss für
jede kleinste Nachjustierung ausgebaut werden!

K4_2_B25
Der
Plattenteller von unten, der gleichzeitig den Draht aufnehmen und als
Schwungmasse für eine konstante Drehzahl sorgen muß.
Man beachte die massive Zink-Druckguß Fertigung! Zusätzlich ist jedes Segment
der Versteifungsstege sorgfältig mit Dämmstoff ausgelegt.
Justage- oder Bedienungsfehler?!

K4_2_B26

Hier muß er durch, oder besser daran vorbei, - und wehe es kommt ein Knoten . . . (dann . . . siehe oben)
Der
Tonkopf seiner Abdeckung entledigt.
Links die Aufnahme-, rechts die Wiedergabespule
Die
Drahtspule:

K4_2_B28
So ist
alles in Ordnung: ca. 2200m (Meter!), bis zu 0,09 mm dünn, stramm aufgewickelt
und mit der für
B&O-Spulen typischen angeknüpften „Fahne“ in der Spule gesichert.
Andere Hersteller hatten hierfür andere Lösungen.
Der
Tonarm:

K4_2_B29
Schon vor
der Demontage des Tonarmes fällt sein hohes Gewicht auf. Was muss das Abtasten
für eine Tortur für die
Schellackplatten gewesen sein! Weit gefehlt!!! Nicht die Abtastnadel stützt das
Gesamtgewicht auf der Platte ab,
sondern ein kleines unauffälliges Bürstchen!
Das Auflagegewicht:

K4_2_B30
Hier ist das erwähnte Bürstchen gut zu erkennen.

K4_2_B31
Es stützt fast das gesamte Gewicht (Tonarm + Tonab- nehmer-system) des Tonarmes auf der Grammophon-Platte ab!

K4_2_B32
Das
Tonabnehmersystem ist auf einem eigenen Träger montiert, der frei auf und ab
schwingen kann.
Nur dieses Eigengewicht ergibt die Auflagekraft der Nadel, - genial!
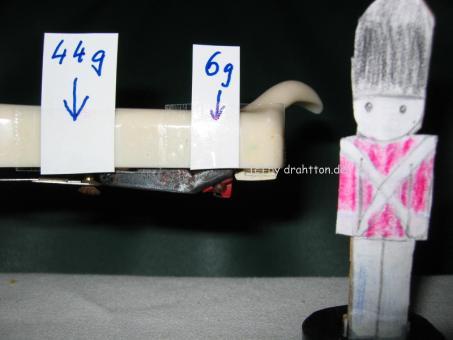
K4_2_B33
Wenn man
sich weiter vergegenwärtigt, dass das Bürstchen immer für einen etwa gleichen
Abstand
zwischen Tonarm und Platte sorgt, wird deutlich, dass ein etwaiger Höhenschlag
einer Platte (was
bei Schellackplatten bei unsachgemäßer Lagerung vorkommen konnte), nahezu
ausgeglichen wird.
Auf diese Weise spielt die Massenträgheit des Systems eine deutlich geringere
Rolle, - toll!
Die
Plattenendabschaltung:

K4_2_B34
Ist mein
Lob unserer Altvorderen zu überschwänglich? Dann sei auf einen weiteres Detail
hingewiesen:
Schellackplatten waren nicht genormt. Sie konnten unterschiedliche Durchmesser
haben. Schlimmer waren
die unterschiedlichen Auslaufrillen. Diese Rille nutzten spätere Plattenspieler
zum Abschalten des Antriebs
(Halbautomat) oder auch zum Zurückführen des Tonarmes (Vollautomat). Sieht man
nun von unten auf das
Bürstchen (es hat also eine weitere Funktion), erkennt man, dass es auf einem
relativ langen Hebel befestigt ist.
Dieser Hebel kann in der Waagerechten frei in beide Richtung schwenken.
Schwenkt von unten gesehen das
Bürstchen nach links (so will es die Rille, die nach innen strebt) führt ein am
anderen Ende befestigter Federdraht
an einen einfachen Niet, an dem ein Kabel angelötet ist. Wird also eine Platte
abgespielt, schwenkt das Bürstchen
den Federdraht gegen den Niet und der Stromkreis ist geschlossen. Läuft zum
Ende die Nadel in die Auslaufrille,
schwenkt der Hebel in die entgegengesetzte Richtung, wodurch der
Antriebsstromkreis geöffnet wird. Ist das zuviel
Lobhudelei? Ich finde diese an sich simplen mechanisch / elektrischen Lösungen
einfach toll!! Und jetzt erklären wir
die Laser- Steuerung eines DVD-Players . . .
Das
Tonabnehmersystem:

K4_2_B35
Hier ist
das Tonabnehmersystem zu sehen: Leider fehlt die Abtastnadel! Schaut man genau
hin, ist deutlich die gar nicht
so kleine Induktionsspule zu sehen. Die Nadel gibt ihre Auslenkungen, die sie
durch das Abtasten der Plattenrille erfährt,
über ein Hebelsystemchen an einen Magneten weiter. Hierdurch werden die
winzigen Bewegungen des Magneten in
der Spule in eine der Auslenkung proportionalen Induktionsspannung umgewandelt.
MMC Moving Magnet würde
man dieses System heute nennen, -Jahrzehnte später!!
Der
Lohn der Mühe:

K4_2_B36
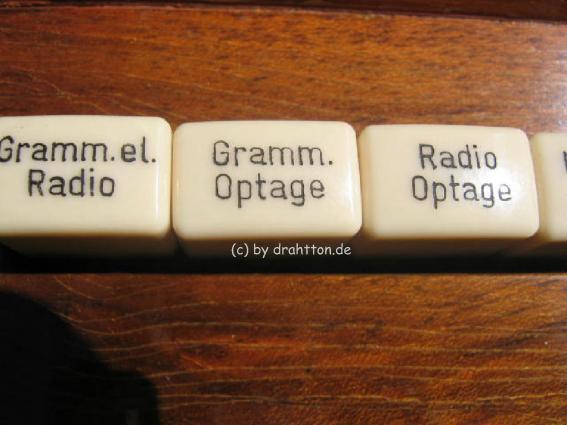
K4_2_B37
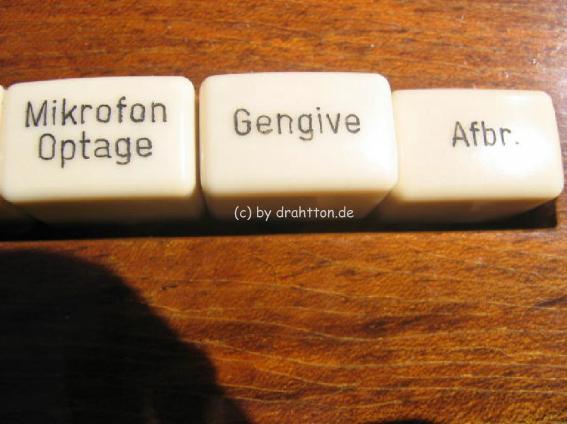

Das
„Zählwerk“ gibt, starr mit dem Antrieb verbunden, recht genau die Spiel- resp.
Restspielzeit in Minuten an.
Eigentlich zu knapp, i.d.Regel werden längere Spielzeiten erreicht!

K4_2_B40
Drehknopf
zur Aussteuerung, Aussteuerungs-Anzeige Wenn es munter flackert kommt
Freude auf. – Die Musik wird fast zur Nebensache!